Quantenforschung
Quantenphänomene wie Superposition, Unschärfe und Verschränkung werden in der Quantenforschung mit dem Ziel untersucht, dass sie bei Bedarf sicher hergestellt und in verschiedenen Disziplinen genutzt werden können.
Der Quantenschlüsselaustausch (quantum key distribution, QKD) ermöglicht beispielsweise die abhörsichere Verschlüsselung von Daten durch Ausnutzung der Quanteneigenschaften von Licht. Bei der Übertragung verschlüsselter Daten in der Quantenkommunikation können für eine optimale Performance Einzelphotonenquellen (single-photon sources, SPS) eingesetzt werden. Unsere schnellen TDCs erleichtern dabei die Entwicklung von Empfängermodulen mit rauscharmer Einzelphotonenzählung, die Einzelphotonendetektionsereignisse in Ströme von Zeitmarken umwandeln – synchronisiert mit der Anregungslaserquelle.
Die Quantensensorik (quantum sensing) hingegen basiert auf der Erkennung von Variationen in der Mikrogravitation unter Verwendung der Prinzipien der Quantenphysik. Die Quantensensorik nutzt verschiedene Eigenschaften der Quantenmechanik von photonischen Systemen oder Festkörpersystemen – wie Quantenverschränkung, Quanteninterferenz und Zustandsreduktion – um die derzeitigen Einschränkungen der Sensortechnologie und des Heisenbergschen Unschärfeprinzips zu überwinden.
Beim Quantencomputing werden die oben genannten kollektiven Eigenschaften von Quantenzuständen zur Durchführung von Berechnungen genutzt. Die Bemühungen, einen physischen Quantencomputer zu bauen, konzentrieren sich derzeit auf Technologien wie Transmonen, Ionenfallen und topologische Quantencomputer, die darauf abzielen, hochwertige Qubits zu erzeugen. Die Annahme ist, dass Quantencomputer in der Lage sind, bestimmte Rechenprobleme so schnell zu lösen, dass kein klassischer Computer in angemessener Zeit mithalten könnte (Quantenüberlegenheit).
Ein typisches Beispiel für die Verwendung von chronologic TDCs in diesem Bereich ist die Forschung von Wolfgang Löffler:
Das Projekt von Wolfgang Löffler in Leiden, Niederlande, liefert Antworten auf aktuelle Fragen der Quantenforschung.
Ein einzelnes Photon gilt heute als einer der am besten geeigneten Kandidaten für die Informationsübertragung in zukünftigen Informationsnetzen. Die photonischen Quantentechnologien gelten als besonders kompetitiv, weil die Dekohärenz kaum noch eine Rolle spielt. Für die Datenübertragung mittels Qubits gilt das Photon auch als der einzige geeignete Träger, da hier die Übertragung durch Glasfasern möglich ist. In Wolfgang Löfflers Laboratorium werden die Gesetze der Quantenphysik, wie z.B. der Photonen-Blockade-Effekt (Interaktion von Licht mit individuellen Halbleiter-Quantenpunkten) genutzt, um einen geordneten Strom einzelner Photonen zu erzeugen. Eines der Projekte seines Teams konzentriert sich darauf, eine Einzelphotonen-Lichtquelle zu entwickeln, die direkt in einer lichtleitenden Glasfaser angeordnet ist. Anwendungen für solch eine Lichtquelle finden sich zuhauf, z.B als photonische Quantengatter, Quantenrepeater und Kurzzeitquantenspeicher. Die aufstrebenden Bereiche moderner Wissenschaft, Quantensensorik, Quantenschlüsselverteilung und natürlich auch die Datenübertragung über große Entfernungen mit Glasfasernetzen warten nur auf solche Bausteine für quantenkryptografische Netzwerke. Und auch logische Operationen im Nanobereich auf einem quantenphotonisch integrierten Halbleiterchip sind heute möglich und bilden den Grundbaustein für die Entwicklung von Quantencomputern.
What is the character of this light?
Physiker betrachten heute in der Regel Laserlicht als klassisches Licht - da es im Labor einfach zu erzeugen ist. Laserlicht besteht allerdings genauer betrachtet aus aus einer großen Mischung von Paketen mit jeweils einer bestimmten Anzahl von Photonen. Wollte man also im Laserlicht eine Photonen-Anzahl bestimmen, dann würde diese der Poisson-Verteilung folgen und wäre folglich „maximally random“. Nicht zuletzt deshalb ist es schwierig, solches Licht in einzelne Photonen umzuwandeln. Damit könnte man folglich keinen Quantencomputer bauen. In Wolfgang Löfflers Institut hingegen, wird ein sogenanntes Quantenlicht erzeugt. Dabei handelt es sich um eine neue Form des Lichtes, die erst seit wenigen Jahren überhaupt hergestellt werden kann - und dies auch nur mit Hilfe aufwändiger Laboraufbauten. Das Quantenlicht zeichnet sich, wie oben bereits erwähnt, dadurch aus, dass es aus einzeln erzeugten Photonen besteht, die im Gigahertz-Frequenzbereich zur Verfügung stehen. Dabei ist die erreichbare Lichtstärke übrigens immerhin so intensiv, dass sie sogar mit einer modernen Handkamera aufgenommen werden kann.

Auch wenn unser Licht aus Photonen besteht, zeigen die Photonen selbst faszinierend unterschiedliche Eigenschaften. Das Team um Wolfgang Löffler untersucht die Verteilung von Photonen-Zuständen im Quantenlicht, welche sich durch ihre Frequenz, Polarisation und Bandbreite unterscheiden. Dabei stellt genau diese Unterscheidbarkeit der Photonen den Schlüssel zum Erfolg dar, wenn es um sichere Datenübertragung geht. Löffler beobachtet zur Bestimmung des Charakters seines Lichts vor allem auch die Emissionsrate, also die Zahl der Photonen, die in einem bestimmten, extrem kleinen Zeitfenster detektiert werden können. Die Messung erfolgt dabei mit Single Photon Detektoren, welche TTL-Pulse erzeugen, die als Click gespeichert werden. Dabei werden die Raw-Photon-Counts erfasst - eine Messung, bei der ca. 1 Millionen TimeTags pro Sekunde aufgezeichnet werden. Die anfallende Datenmenge ist also erheblich. Für die Messung werden die cronologic TimeTagger4 herangezogen.
Wie genau wird Quantenlicht erzeugt?
Zur Erzeugung von Single-Photon-States wird typischerweise ein Elektron in einem Quantenpunkt, also in einem künstliches Atom mit Abmessungen von nur wenigen Nanometern, mittels Licht angeregt. Dieser Quantenpunkt kann zwei Energieniveaus einnehmen. Innerhalb des Quantenpunktes wird jedes Mal, wenn er sich auf das niedrigere Energieniveau entspannt, ein einzelnes Photon emittiert. Bei diesem Vorgang kann nach dem Pauli exclusion Prinzip ausschließlich eine einzige Anregung erfolgen. Somit sendet das relegierende Elektron genau ein Photon aus.
Der besagte Quantenpunkt befindet sich in einer optischen Mikrokavität, deren Wände Licht reflektieren. Dieser Aufbau dient dazu, die Richtung und Intensität der Lichtwellen zu steuern. Die Farbe eines Lasers wird über die Resonanz der optischen Kavität gescannt. Innerhalb der Resonanzfrequenz ist die Transmission maximal, denn Photonen, die außerhalb der Resonanzfrequenz auftreffen, werden von der Spiegelanordnung innerhalb der Kavität reflektiert (photon-blockade effect). Hohe Photonenemissionsraten erfordern dabei allerdings eine anspruchsvolle und hochpräzise Vorgehensweise bei der Herstellung der Kavitäten.
Die Steuerung des Quantenlichtes erfolgt in Löfflers Labor mittels elektrischer Verschiebung des Quantenpunktes in den Wellenleiter-Bereich, so dass die Transmission der unerwünschten Photonen gezielt unterdrückt werden kann. Das Besondere: Man bedient sich dabei des Effektes der „unkonventionellen Photonenblockade“, bei dem zur Erzeugung eines Stroms einzelner Photonen die der Quanteninterferenz verschiedener Polarisationen der Photonen geschickt ausgenutzt werden. Das Teamverwendet zwei orthogonal polarisierte Modi derselben Kavität. Dabei ermöglicht diese Nutzung der Hohlraumquantenelektrodynamikeffekte eine Kopplungsstärke von nahezu eins. Dieser Vorgang ist dabei auch umkehrbar.

Mit diesem Aufbau ist es den Wissenschaftlern möglich, mit einer Taktung von etwa einer Milliarde pro Sekunde einzelne Photonen zu erzeugen. Die Interaktion des Lichts innerhalb dieses optischen Resonators ist inzwischen so gut, dass in der Regel bereits die Absorption eines einzigen Photons im Quantenpunkt registriert wird. Und auch das Aussenden eines einzelnen Photons kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der nachfolgenden optischen Phase aufgefangen werden. Löfflers Methode der Erzeugung von Quantenlicht skaliert offenbar deutlich besser, als die klassische Methode der Spontaneous Parametric Down Conversion (SPDC).
Zum aktuellen Stand dieser Forschung
Das Institut ist heute in der Lage, künstliche Lichtzustände zu entwickeln, die denen von kohärentem Laserlicht sehr ähnlich, und somit relativ unempfindlich gegenüber Störung in der Übertragung sind. Dabei wird sinngemäß das kohärente Licht aus seinen Einzelkomponenten zusammengesetzt. Es gibt dabei jedoch einen kleinen aber feinen Unterschied zum klassischen Licht: Das künstliche Licht weist zu verschiedenen Zeiten eine gewisse Quantenverschränkung zwischen Photonen auf, sogenannte photonische Clusterzustände. Dabei ist die Korrelation der Photonen in einem Linear-Cluster-State so stark, dass damit Quanteninformationen übertragen werden könnten. Und zwar zu 100% sicher und mit dem Potential, neue Rekorde in der Superauflösung in der Mikroskopie aufzustellen. Aktuell werden etwa drei bis vier Quanten (z.B. mit Hilfe ihres Elektronenspins) miteinander verschränkt. Das Ziel Löfflers Forschung ist es nun, eine skalierbare, deterministische Quelle von 20 oder mehr verschränkten Photonen zu entwickeln, um somit eine leistungsfähige Ressource für Photonic Quantum Computing zu erschaffen.

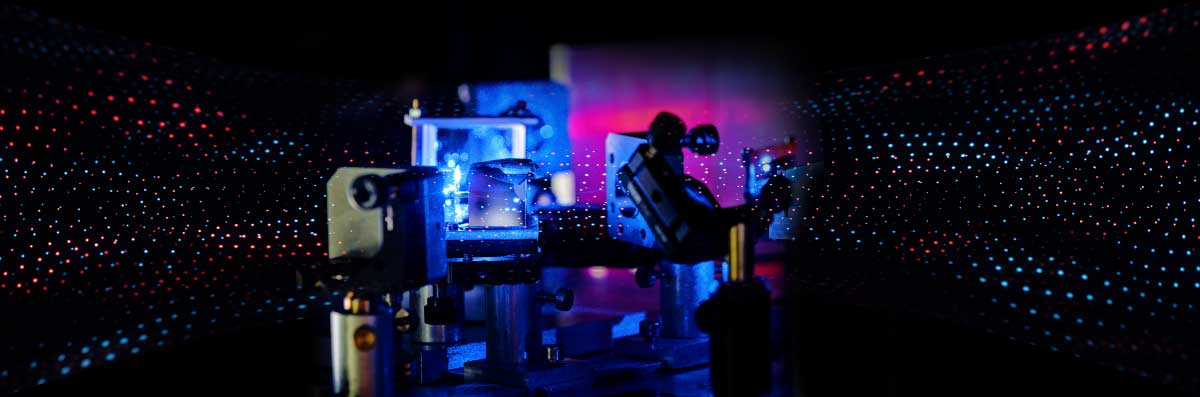




An dieser Stelle möchten wir Besuchern unserer Website, die sich für die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte interessieren einen kleinen Einblick geben. Wir selbst beschäftigen uns in erster Linie mit den Anforderungen unserer Kunden in Hinblick auf die Datenerfassung und sind weder Chemiker, Biologen oder Mediziner, noch bauen wir Massenspektrometer oder Bildgebungssysteme. Es macht uns einfach Spaß, von unseren Kunden zu lernen und das Gelernte mit denen zu teilen, die sich für unsere Arbeit interessieren. Die folgenden Inhalte sind daher keine wissenschaftlichen Abhandlungen, sondern spiegeln auch subjektive Eindrücke wider.